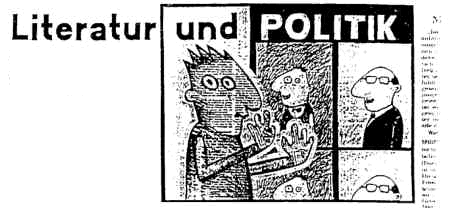
Bremerhaven
Literatur und Politik e.V.
c/o Wolfgang Richter
Apelerweg 17
27574 Bremerhaven
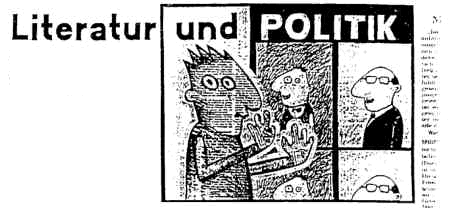
Bremerhaven
Literatur und Politik e.V.
c/o Wolfgang Richter
Apelerweg 17
27574 Bremerhaven
Roman
Zum Inhalt:
Deutschland, 2033. Die rechtsextreme Partei AUFSTAND stellt die
Bundeskanzlerin. Als die junge Anwältin Marie Wigand ihrer Chefin bei
einem neuen Strafprozess assistieren soll, ahnt sie noch nichts von seinem
historischen Ausmaß. Die Generalsekretärin der einzigen Oppositionspartei
REFORM wird angeklagt, hinter einem Bombenanschlag auf die
Parteizentrale des AUFSTANDs zu stecken. Doch schnell stellt sich heraus,
dass es nicht allein um Schuld oder Unschuld geht: Sollte die Politikerin
verurteilt werden, droht ein Verbot ihrer Partei – und der Weg für den
AUFSTAND wäre frei, das Grundgesetz abzuschaffen. Ein Rennen gegen
die Zeit beginnt, und Marie findet sich in einem Kampf zwischen David und
Goliath wieder, in dem es auch für sie selbst immer gefährlicher wird ...
Ein beklemmendes Gedankenexperiment: Wie wehrhaft ist unsere
Demokratie?
„Bijan Moinis neuen Roman sollten Sie lesen. Ihre Welt wird danach eine andere sein.“
Ferdinand von Schirach

Foto © Simon Detel
Bijan Moini, 1984 geboren bei Karlsruhe, ist Jurist, Politologe und Bürgerrechtler mit deutschiranischen
Wurzeln. Nach Promotion und Referendariat in Hongkong und Berlin arbeitete er als Rechtsanwalt für eine
Wirtschaftskanzlei. Als ihm die Idee zu seinem ersten Roman kam, kündigte er und widmete sich dem
Schreiben. 2019 erschien „Der Würfel“ im Atrium Verlag. Heute arbeitet er für die Gesellschaft für
Freiheitsrechte und tritt im Fernsehen, Hörfunk sowie in zahlreichen Print- und Onlinemedien als Experte für
Freiheitsrechte in Erscheinung. Er stand bereits mehrfach vor dem Bundesverfassungsgericht und erarbeitet
seit dem Frühjahr 2025 federführend ein großes Gutachten zur AfD. Moini lebt mit seiner Familie in Berlin.
Das Buch „2033“ ist im Atrium-Verlag erschienen.
Veranstalter: Literatur und Politik e.V. in Kooperation mit der Stadtbibliothek Bremerhaven
Mittwoch, 12. Nov. 2025, 19:00 Uhr
in der Stadtbibliothek Bremerhaven, Hanse-Carré, Bgm.-Smidt-Str. 10
Eintritt: „zahle, was es dir wert ist bzw. was du kannst“
(statt € 10 / ermäßigt € 5)
Kartenreservierung:
Stadtbibliothek oder Mail an: info@litupol-fischtown.de
Denglers elfter Fall
Aus Sorge um seine Mutter reist Georg Dengler in den Schwarzwald. Über den Hof, auf dem er seine Kindheit verbracht hat, schleichen nachts Gestalten. Oben am Feldberg besitzt die Familie Dengler ein Grundstück – die ideale Lage für ein Windrad. Wäre da nicht der örtliche Widerstand. Georgs Jugendliebe, mittlerweile die Heilpraktikerin seiner Mutter, ist eine der Wortführerinnen. Nachdem die Denglers auf einer schmalen Straße abgedrängt werden, landet Margret im Krankenhaus – und ihr Sohn ist endgültig beunruhigt.
Um zu finden, was nächtliche Eindringlinge suchen könnten, stöbert Georg durch das Inventar mehrerer Leben, das in den Winkeln des weitläufigen Hauses verstaut ist: Seit Generationen war der Hof Familienbesitz, erst nach dem Unfalltod ihres Mannes gab Margret die Landwirtschaft auf. Aber auch das scheint plötzlich nur noch die halbe Wahrheit zu sein.
Statt auf Antworten stößt Dengler auf immer neue Fragen: Wer sind die Kerle auf dem Hof und wer hat sie geschickt? Wer war sein Vater, bevor er ein treusorgender Ehemann wurde? Wieso liegt Auerhahnkot am Feldberg, wo seit Jahren keiner der Vögel mehr gesehen wurde? Als er feststellt, dass seine Familie sich inmitten erbittert geführter Kämpfe um die Zukunft unserer Energiegewinnung befindet, ist es fast zu spät: Nach einem Sturz liegt seine Mutter im Koma. Und draußen, im Schutz der Dunkelheit, schleicht eine Wölfin um eine Leiche. (KiWi-Verlagstext)

Foto © Timo Kabel
Wolfgang Schorlau lebt und arbeitet als freier Autor in Stuttgart. 2006 wurde er mit dem Deutschen Krimipreis, 2012 und 2014 mit dem Stuttgarter Krimipreis sowie 2019 mit dem Stuttgarter Ebner-Stolz-Wirtschaftskrimipreis ausgezeichnet. In seinen Kriminalromanen kritisiert er politische und gesellschaftliche Verhältnisse auf der Basis gründlicher Recherchen. Seine Bücher erscheinen im Verlag Kiepenheuer & Witsch. „Black Forest“, Paperback, € 18,00.
Veranstalter: Literatur und Politik e.V. in Kooperation mit KLIMAHAUS® Bremerhaven
Die Veranstaltung fand statt am Freitag, 20. Juni 2025, um 19 Uhr
im KLIMAHAUS® Bremerhaven, Raum Kyoto.
 Diese Lesung passt zur KLIMAHAUS-Sonderausstellung KLIMA_X – Die Reise durch Klima,
Kommunikation und Verhalten.
Diese Lesung passt zur KLIMAHAUS-Sonderausstellung KLIMA_X – Die Reise durch Klima,
Kommunikation und Verhalten.
Der gerade veröffentlichte Paritätische Armutsbericht stellt fest, dass die Armut in Deutschland auch in den letzten Jahren zugenommen hat, im Bundesland Bremen ist jede 4. Person (25,9 Prozent) von Armut betroffen.
Der bekannte Politikwissenschaftler und Armutsforschen Christoph Butterwegge behandelt in einer Veranstaltung des Vereins Literatur und Politik e.V. in Kooperation mit der Arbeitnehmerkammer die Frage, warum Armut seit geraumer Zeit bis in die Mitte der Gesellschaft vordringt, während sich der Reichtum immer stärker bei wenigen (Unternehmer-)Familien konzentriert.
Er beschäftigt sich mit den Ursachen der wachsenden sozialen Ungleichheit und den Maßnahmen, mit denen ihr Einhalt zu gebieten wäre. Behandelt werden drei Ursachenbündel im Zusammenhang mit ausschlaggebenden (Fehl-)Entscheidungen von Parlament und Regierung: die Deregulierung des Arbeitsmarktes, die Demontage des Sozialstaates und die Deformation des Steuersystems, verstärkt durch die Covid-19-Pandemie, die Energiepreisexplosion aufgrund des Ukrainekrieges und die durch beide Krisenphänomene ausgelöste Inflation.
Butterwegge analysiert, was getan werden müsste, um mehr Gleichheit und soziale Gerechtigkeit zu erreichen.

Foto © Markus J. Feger
Prof. Dr. Christoph Butterwegge lehrte von 1998 bis 2016 Politikwissenschaft an der Universität zu Köln und kandidierte 2017 für das Amt des Bundespräsidenten.
Die Veranstaltung fand statt am Mittwoch, 04. Juni 2025, um 19.30 Uhr
im „Forum“ der Arbeitnehmerkammer, Barkhausenstraße 16
Veranstalter: Literatur und Politik e.V. in Kooperation mit
der Arbeitnehmerkammer Bremen

Zu den Folgen von „Zeitenwende“ und „Kriegstüchtigkeit“ – auch für Schulen & Universitäten
Nach Ausrufung von „Zeitenwende“ und „Kriegstüchtigkeit“ gehen nicht nur hunderte Milliarden öffentlicher Gelder auf Kosten des Sozialstaates in die Rüstungsindustrie und deren Waffen an Kriegsparteien und in Kriegsgebiete. Damit einher geht auch die Militarisierung ziviler Bereiche sowie ein Kampf um die Köpfe – letztlich mit dem Ziel, Bundeswehr und Gesellschaft kriegstüchtig und kriegsbereit zu machen. Auch Schulen und Universitäten sind davon nicht ausgenommen.
So werden etwa in Bayern Schulen, Universitäten, Bildung, Wissenschaft und Forschung seit letztem Jahr per Gesetz zu enger Kooperation mit der Bundeswehr verpflichtet. Schulen sollen sich öffnen für „Jugendoffiziere“ und „Karriereberater“ der Bundeswehr. Die Selbstverpflichtung von Wissenschaft und Forschung per „Zivilklauseln“, ausschließlich für friedliche Zwecke zu forschen, ist in Bayern gesetzlich verboten. Forschung und ihre Ergebnisse müssen also auch für Rüstungsindustrie, Bundeswehr und Nato unmittelbar zugänglich sein.
Gegen solche Militarisierungstendenzen setzen sich hierzulande viele Menschen, viele Betroffene, ihre Gewerkschaften und zahlreiche Verbände zur Wehr. Und sie zogen vor Kurzem mit einer breit unterstützten Popularklage vor Gericht, um Wissenschafts- und Forschungsfreiheit, Hochschulautonomie sowie Gewissensfreiheit an Schulen zu verteidigen.
 Dr. Rolf Gössner
ist Jurist, Publizist und Bürgerrechtsaktivist. Er ist Mitherausgeber des jährlich erscheinenden „Grundrechte-Reports“ und Kuratoriumsmitglied der „Internationalen Liga für Menschenrechte“; außerdem war er viele Jahre stellv. Richter am Staatsgerichtshof der Freien Hansestadt Bremen. Autor zahlreicher Bücher zum Themenspektrum Innere Sicherheit, demokratischer Rechtsstaat, Grund- und Freiheitsrechte.
Dr. Rolf Gössner
ist Jurist, Publizist und Bürgerrechtsaktivist. Er ist Mitherausgeber des jährlich erscheinenden „Grundrechte-Reports“ und Kuratoriumsmitglied der „Internationalen Liga für Menschenrechte“; außerdem war er viele Jahre stellv. Richter am Staatsgerichtshof der Freien Hansestadt Bremen. Autor zahlreicher Bücher zum Themenspektrum Innere Sicherheit, demokratischer Rechtsstaat, Grund- und Freiheitsrechte.
Foto: © Michael Bahlo
Die Veranstaltung fand statt am Donnerstag, d. 27.März 2025 um 19.00 Uhr
im Pferdestall, Gartenstraße 5-7
Veranstalter: Literatur und Politik e.V. in Kooperation mit der GEW Stadtverband Bremerhaven
Oratorium in elf Gesängen
 Die Ermittlung.
Die Ermittlung.
Oratorium in elf Gesängen
Film Deutschland 2024 240 Minuten
Regie: RP Kahl Buch: Peter Weiss
Dieser Film ist eine Zumutung.
„Ein geschlossener Raum, mehr als 60 namhafte Darsteller*innen, vier Wochen Probe, fünf Drehtage mit bis zu acht Kameras, die das Geschehen festhielten, und eine Laufzeit von 240 Minuten: RP Kahls „Die Ermittlung“ ist ... eine der ungewöhnlichsten Filmproduktionen der letzten Zeit.“ So schreibt Joachim Kurz in seiner Besprechung, die er mit „Das Grauen entsteht im Kopf“ überschreibt.
Der Film entstand nach der Bühnenvorlage von Peter Weiss aus dem Jahr 1965. Peter Weiss nahm als Zuschauer am Auschwitzprozess teil und entwickelte sein Stück aus den Protokollen Bernd Naumanns, dessen Berichte für die FAZ nach dem Urteil Hannah Arendts als die „solidesten“ galten. Peter Weiss` Stück „Die Ermittlung. Oratorium in 11 Gesängen“ wurde zum am häufigsten gespielten und umstrittensten Theaterstück der damaligen Bundesrepublik Deutschland.
Dazu ein kurzer Blick auf das Jahr 1963. Nach fast 20 langen Jahren des Schweigens beginnt auch öffentlich die Auseinandersetzung mit den ungeheuerlichen Verbrechen der Vergangenheit. In Frankfurt beginnt der Auschwitzprozess (1963 – 1965)“, vorbereitet und gegen starke Widerstände aus der Justiz durchgesetzt von Generalstaatsanwalt Dr. Fritz Bauer. Der junge Dramatiker Rolf Hochhuth veröffentlicht „Der Stellvertreter“ und die Uraufführung in Westberlin sorgt für Aufruhr und heftige Debatten. Heinrich Böll schreibt den Roman „Ansichten eines Clowns“. Und Ende 1963 tritt Konrad Adenauer 86jährig vom Amt des Bundeskanzlers zurück.
Das Theaterstück „Die Ermittlung“ wurde am 19. Oktober 1965 im Rahmen einer Ring- Uraufführung gleichzeitig an fünfzehn west- und ostdeutschen Theatern sowie von der Royal Shakespeare Company, London, uraufgeführt. In Schweden inszenierte Ingmar Bergman das Stück für das Stockholmer Theater.
In einer Zeit, in der immer unverblümter und lauter die Verbrechen des Nationalsozialismus relativiert oder sogar geleugnet werden, hält der Film „Die Ermittlung“ dagegen, mit nichts als „der nackten Faktizität“, wie Peter Weiss es genannt hat
„ Die Ermittlung ist ein filmisches Monument des Erinnerns. ... Und es wäre nicht nur wünschenswert, sondern dringend notwendig, dass sich viele Menschen dem auszusetzen bereit sind.“ (J. Kurz, Kino-Zeit)
Und Jochen Werner (Filmstarts) schreibt:
„Man kann nur dringend anraten, sich auf diese essenzielle filmische Auseinandersetzung mit den leider auch heute hochaktuellen Themen Faschismus, Genozid und Zivilisationsbruch einzulassen. Wahrscheinlich gibt es, dem Bühnen-setting zum Trotz, gerade keinen Film, der unbeirrter an die Kraft des Kinos glaubt.“
Wir hoffen auf viele, die sich dieser Zumutung stellen.
Wir von Literatur und Politik haben vorab die vorliegenden Informationen vom KoKi übernehmen dürfen.
Vortrag und Diskussion
Axel Salheiser
Klimakrise und Demokratiegefährdung
Klima und Demokratie gehören zusammen
Rechtsextremisten inszenieren gezielt Desinformationskampagnen, um Stimmung gegen die ökologische Wende zu machen. Klimaschädliche Emissionen, Lobbyinteressen, Leugnung des Klimawandels und politische Instrumentalisierung von Verlustängsten: Das Klima, die soziale Gerechtigkeit und die liberale Demokratie werden zunehmend heftiger angegriffen.
Der Soziologe Dr. Axel Salheiser wird in seinem Vortrag darlegen, wie Rechtsaußenparteien den Klimawandel für sich nutzen, wo die massiven politischen Gefahren des Rückschlags gegen den grünen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft liegen, mit welchen Netzwerken und Argumentationsweisen die Rechten die Zukunft angreifen, was das mit unserem Alltag und dem herrschenden System zu tun hat und was wir für Klima und Gerechtigkeit tun können.
 Axel Salheiser ist Soziologe und seit Februar 2022 wissenschaftlicher Leiter am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) Jena sowie Sprecher des Teilinstituts Jena des Forschungszentrums gesellschaftlicher Zusammenhalt (FGZ). Er leitet u.a. ein Projekt zum „Internationalen Rechtspopulismus im Kontext globaler ökologischer Krisen“ und forscht zu Rechtsextremismus und anderen Gefährdungspotenzialen der demokratischen Kultur. Von 2002 bis 2019 forschte und lehrte Salheiser an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Er ist Mitherausgeber mehrerer wissenschaftlicher Sammelbände zur Eliten- und Demokratieforschung und Koautor zahlreicher Fachveröffentlichungen.
Axel Salheiser ist Soziologe und seit Februar 2022 wissenschaftlicher Leiter am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) Jena sowie Sprecher des Teilinstituts Jena des Forschungszentrums gesellschaftlicher Zusammenhalt (FGZ). Er leitet u.a. ein Projekt zum „Internationalen Rechtspopulismus im Kontext globaler ökologischer Krisen“ und forscht zu Rechtsextremismus und anderen Gefährdungspotenzialen der demokratischen Kultur. Von 2002 bis 2019 forschte und lehrte Salheiser an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Er ist Mitherausgeber mehrerer wissenschaftlicher Sammelbände zur Eliten- und Demokratieforschung und Koautor zahlreicher Fachveröffentlichungen.
Foto: © Privat / Piper Verlag
Zum Buch „Klimarassismus“, erschienen bei Piper, verfasst von den Autoren Quent, Richter und Salheiser.
Seit dem 11. September 2001 erlebt die Welt in schneller Reihenfolge immer neue Kriege: Afghanistan, Irak, Jemen, Libanon, Libyen, Syrien, Ukraine und jetzt Israel-Gaza. Begleitet werden sie von internationalen Medien, die das Kriegsgeschehen in die Schlagzeilen transportieren. Mit jedem neuen Krieg drohen die vorherigen Kriege vergessen zu werden und damit auch die toten, geflüchteten und verletzten Menschen, die zerstörten Ökonomien und die vernichteten Lebensgrundlagen.
Die Zahl der Flüchtlinge in der Welt hat sich seit 2001 nahezu verzehnfacht. Zählte das UN-Hilfswerk für Flüchtlinge (UNHCR) damals noch 12 Millionen Flüchtlinge, wird ihre Zahl im Juli 2023 mit 108 Millionen angegeben.
Wer denkt noch an Syrien? Nach Protesten wegen der Verhaftung von Kindern in der südsyrischen Stadt Dara 2011 setzte die Regierung die reguläre Armee gegen die Demonstranten ein. Mehrere hundert Menschen wurden getötet. In der Folge entwickelte sich ein bis heute andauernder Krieg, der geprägt ist von einander widersprechenden internationalen, regionalen und nationalen Interessen und Akteuren. 2018 gab es in Syrien etwa 6,2 Mio. Binnenflüchtlinge und 6,5 Mio. Menschen waren ins Ausland geflohen. Heute leben 90 Prozent der rund 18 Millionen verbliebenen Syrer unter der Armutsgrenze von 1 US-Dollar pro Tag (ca. 1 Euro). Die Hilfe von internationalen Organisationen der Vereinten Nationen, staatlichen und privaten Hilfsorganisationen oder vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz kann den Bedürfnissen der Menschen nicht gerecht werden. Das durch das Erdbeben 2023 noch verschärfte Elend in Syrien droht vergessen zu werden.
Karin Leukefeld wird einen geopolitischen Überblick über die sehr komplizierte Situation in Syrien geben und versuchen folgende Fragen zu beantworten:

Karin Leukefeld studierte Ethnologie, Islam- und Politikwissenschaften und ist seit dem Jahr 2000 als freie Korrespondentin im Mittleren Osten tätig.
Karin Leukefeld hat u.a. folgende Bücher veröffentlicht:
„Syrien zwischen Schatten und Licht – Menschen erzählen von ihrem zerrissenen Land“ (2016)
„Flächenbrand – Syrien, Irak, Die Arabische Welt und der Islamische Staat" (überarb. 3. Auflage 2017).
Die Klimakrise ist seit 2019 in aller Munde und auch in der Politik eines der wichtigsten Themen. Doch bekannt waren die Auswirkungen der Klimakrise schon lange. Wieso verdrängen wir die Bedeutung der Klimakrise? Liegt es auch daran, dass Medien zur Aufklärung unzureichend beitragen?
Heute ist die Berichterstattung zwar umfänglicher, doch viele Medienhäuser und (prominente) Journalisten scheinen häufig Wissenslücken über die Klimakrise und Klimapolitik zu haben.
Wenn im Bundestagswahlkampf 2021 in keinem Format ernsthaft über die Diskrepanz zwischen 1,5°-konformer Politik und den Klimaplänen der Parteien geredet wurde, wenn in Talkshows nur darüber geredet wird, wie man am besten seinen individuellen CO2-Fußabdruck reduzieren kann, werden dann die Medien ihrer Aufgabe gerecht?
Wird die Klimakrise in der Berichterstattung genauso ergiebig behandelt wie Börsenzahlen oder Sportereignisse?
Verkaufen sich deprimierende Nachrichten über das Klima schlechter?
Wie kann es sein, dass während der Corona-Pandemie jeder wusste, was eine Inzidenzzahl oder ein R-Wert bedeuten und welches Land gerade wie die Corona- Pandemie bewältigt, aber heute kaum jemand weiß, was ein CO2-Budget ist und immer noch viele Menschen hartnäckig an dem Mythos festhalten, dass Deutschland Vorreiter im Klimaschutz sei?
Wie abhängig sind Medienhäuser von finanziellen Einnahmen durch Werbeanzeigen von Auto-, Kreuzfahrt- oder Energieunternehmen?
Welche Rolle also spielen Medien in der Klimakrise? Kommen sie ihrer Aufgabe als „Vierte Gewalt“ in der Demokratie hinreichend nach?
Und natürlich, wie kann sich die Berichterstattung verbessern?

Christoph Linne, Chefredakteur der NORDSEE-ZEITUNG
Jan Weyrauch, Programmdirektor Radio Bremen
Friederike Mayer, 1.Vors. der Initiative KLIMA° vor acht e.V.
Lea Dohm, Dipl.-Psych., Psychologists / Psychotherapists for Future (Psy4F)
Die Podiumsdiskussion fand statt am Dienstag, 7. März 2023, um 19:00 Uhr
|
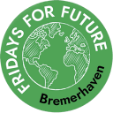
|
Warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind – und wie wir in Zukunft leben werden.
Demokratie und Wohlstand, ein längeres Leben, mehr Gleichberechtigung und Bildung: Der Kapitalismus habe viel Positives bewirkt. Zugleich ruiniere er jedoch Klima und Umwelt, sodass die Menschheit nun existenziell gefährdet ist. »Grünes Wachstum« soll die Rettung sein, aber Wirtschaftsexpertin und Bestseller-Autorin Ulrike Herrmann hält dagegen: Verständlich und messerscharf erklärt sie in ihrem neuen Buch, warum wir stattdessen »grünes Schrumpfen« brauchen.
Die Klimakrise verschärft sich täglich, aber konkret ändere sich fast nichts. Die Treibhausgase nehmen ungebremst und dramatisch zu. Dieses Scheitern sei kein Zufall, denn die Klimakrise ziele ins Herz des Kapitalismus. Wohlstand und Wachstum seien nur möglich, wenn man Technik einsetzt und Energie nutzt. Leider werde die Ökoenergie aus Sonne und Wind aber niemals reichen, um weltweites Wachstum zu befeuern. Die Industrieländer müssen sich also vom Kapitalismus verabschieden und eine Kreislaufwirtschaft anstreben, in der nur noch verbraucht wird, was sich recyceln lässt.
Aber wie soll man sich dieses grüne Schrumpfen vorstellen?
Über den Inhalt ihres Buches wollen wir in der Veranstaltung mit Frau Herrmann diskutieren.

Foto © Andrew James Johnston
Ulrike Herrmann, geb. 1964 in Hamburg, Ausbildung zur Bankkauffrau, Studium von Philosophie und Geschichte, Absolventin der Henri-Nannen-Schule. Seit 2000 Wirtschaftskorrespondentin der taz und Publizistin zu sozial- und wirtschaftspolitischen Themen. 2010 erschien ihr erstes Buch „Hurra, wir dürfen zahlen. Über den Selbstbetrug der Mittelschicht” im WestendVerlag. In Folge publizierte sie dort mit „Der Sieg des Kapitals”, „Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung”, „Deutschland, ein Wirtschaftsmärchen” weitere Bücher, die sämtlich Bestseller geworden sind (im Schnitt 40.000 Exemplare pro Titel). In der letzten Zeit wird sie immer häufiger als Kommentatorin zu politischen Talkshows eingeladen (Phoenix-Runde, Maischberger, Lanz). Einen Namen gemacht hat sie sich nicht zuletzt mit ihren zahlreichen brillanten Vorträgen zu Wirtschaftsthemen bei Stiftungen, Instituten, Universitäten etc.
„Das Ende des Kapitalismus” Verlag Kiepenheuer & Witsch, 352 Seiten, € 24.
Zum Einlesen gab es als Empfehlung den verlinkten taz-Artikel